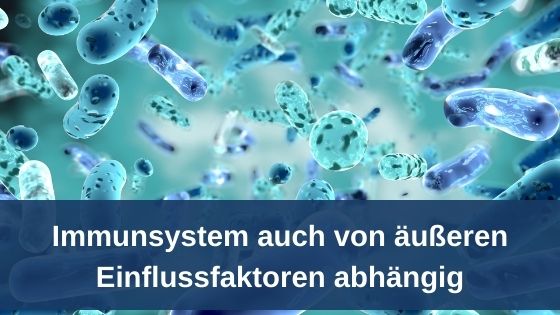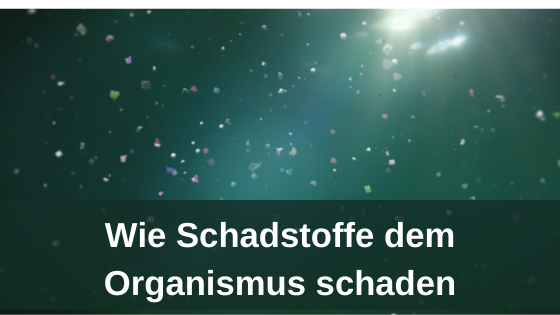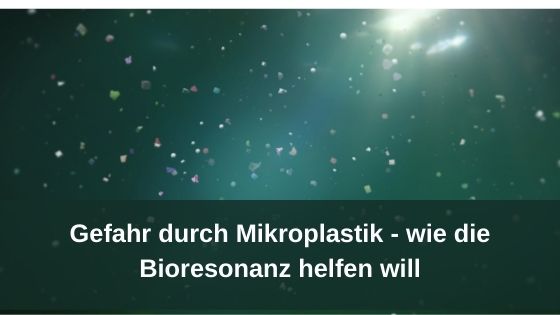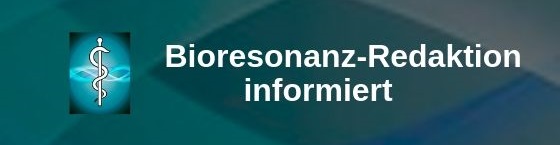Forscher warnen vor den langfristigen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf die menschliche Gesundheit
Ein Forschungskonsortium der Universität Wien, unter anderem, hat eine Studie durchgeführt, um die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastikpartikeln (MNPs) auf Zellen im menschlichen Magen-Darm-Trakt zu untersuchen.
Es wurde festgestellt, dass MNPs im Vergleich zu anderen Fremdkörpern im Körper länger in den Zellen verbleiben, da sie bei der Zellteilung an die neu gebildeten Zellen weitergegeben werden.
Zusätzlich wurden direkte Auswirkungen beobachtet, wie die Aufnahme von MNPs in den Zellorganellen Lysosomen, die normalerweise Fremdkörper abbauen. Interessanterweise werden MNPs aufgrund ihrer körperfremden chemischen Zusammensetzung im Gegensatz zu biologischen Fremdkörpern nicht abgebaut. Stattdessen bleiben sie in den Zellen bestehen und können möglicherweise langfristige Effekte haben.
Wie Mikro- und Nanopartikel Krebs begünstigen
Besonders beunruhigend ist die Feststellung, dass MNPs die Zellmigration von Krebszellen in andere Körperregionen verstärken könnten, was die Metastasierung von Tumoren begünstigen könnte.
Die Studie zeigt auch, dass Nanoplastikpartikel, die kleiner als ein Mikrometer sind, besonders schädlich sein können. Dies unterstreicht die Dringlichkeit weiterer Untersuchungen, um die Langzeitauswirkungen von MNPs auf die Gesundheit des Menschen besser zu verstehen.
Angesichts der weit verbreiteten Exposition gegenüber Kunststoffen und der fortlaufenden Aufnahme von Plastikpartikeln durch den Menschen sind diese Ergebnisse von hoher Relevanz für die öffentliche Gesundheit. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken zu verstehen und geeignete Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit zu ergreifen.
(Quelle: Aufgenommenes Mikro- und Nanoplastik wird bei Zellteilung weitergegeben, Universität Wien, Informationsdienst Wissenschaft (idw))
Schlussfolgerung der Bioresonanz-Experten
Für Bioresonanz-Experten bestätigt sich damit ihre schon lange bestehende Befürchtung, dass der Einfluss von solchen Schadstoffen auf die Gesundheit von nachhaltiger Bedeutung ist. Da wir diesen Belastungen nun einmal ausgesetzt sind, setzen sie darauf, den Organismus möglichst optimal zu unterstützen, um die Chance zumindest zu eröffnen, mit Folgen daraus besser fertig zu werden.
Wichtig ist es, so ihre Erfahrung, den gesamten Organismus dabei einzubeziehen. Dazu gehört es, die zentralen Regulationssysteme, wie der Stoffwechsel, die Ausleitung, die Immunabwehr und die Steuerungssysteme (Hormon- und Nervensystem) in einer ganzheitlichen Therapiemaßnahme zu berücksichtigen.
Inwieweit es damit gelingt, eine Art Gegengewicht zur Belastung zu schaffen, ist naturgemäß offen und hängt von den individuellen Verhältnissen der jeweils Betroffenen ab.
Nutzen Sie auch zur vertiefenden Information den kostenlosen eReport „Bioresonanz – eine Chance für die Gesundheit“. Mehr dazu hier:
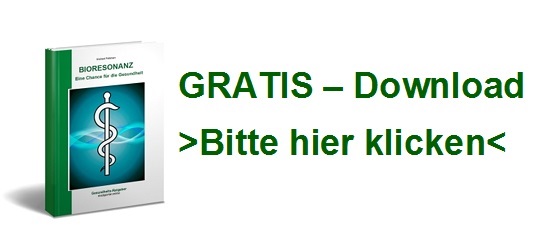
Wichtiger Hinweis: Die Bioresonanz gehört in den Bereich der Erfahrungsmedizin. Die klassische Schulmedizin hat die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt. Die dargestellten Zusammenhänge gehen deshalb teilweise weit über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinaus.
Diese Seiten dienen zu Ihrer Information und Anregung. Sie ersetzen keinesfalls den Arzt oder Heilpraktiker im konkreten Krankheitsfalle.