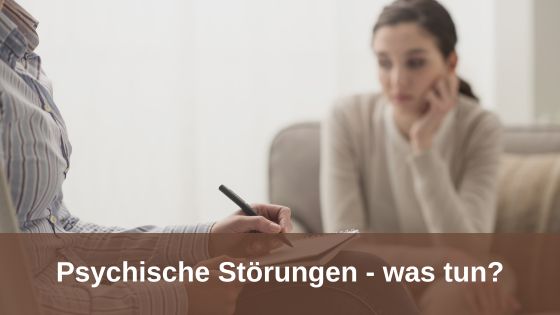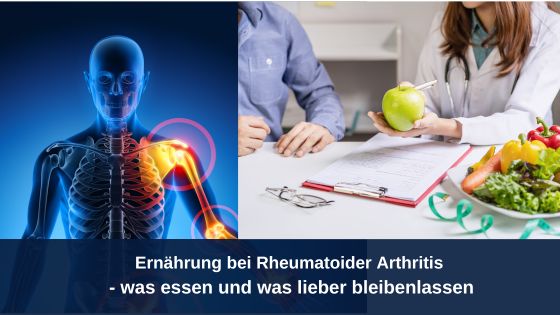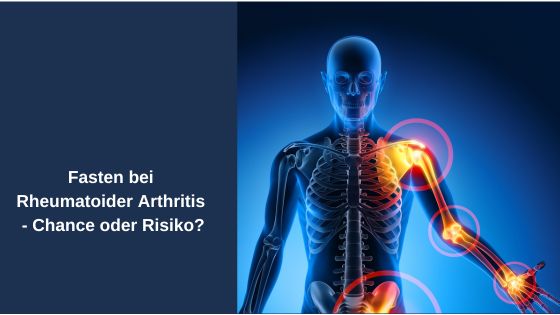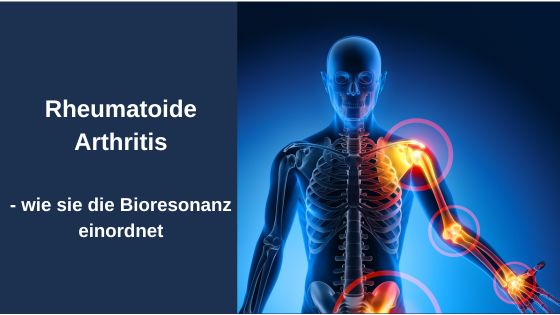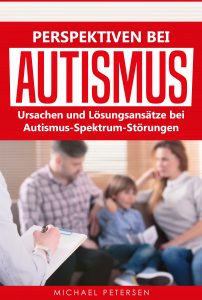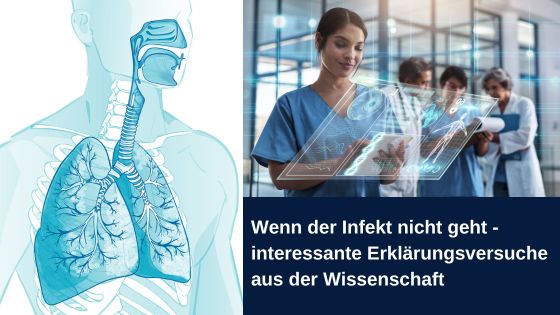Die Bioresonanz-Redaktion stellt die Ansätze der verschiedenen Therapeuten vor und was man selbst tun kann.
Psychische Störungen – was tut der Arzt?
Am Anfang steht ein Gespräch mit dem Arzt, welche Beschwerden bestehen und wie lange sie schon andauern. Oft werden auch Fragen zum Alltag, zur Arbeit, zur Familie oder zu früheren Erkrankungen gestellt, um ein umfassendes Bild zu bekommen.
Anschließend prüft der Arzt, ob körperliche Ursachen eine Rolle spielen könnten, zum Beispiel durch Blutuntersuchungen oder andere Tests. Das ist wichtig, weil manche körperlichen Erkrankungen ähnliche Symptome hervorrufen können wie eine psychische Störung.
Je nach Situation kann der Arzt selbst eine Behandlung beginnen, etwa mit Gesprächen, Medikamenten oder Empfehlungen zu Entspannung und Lebensstil. Häufig überweist er aber auch je nach Beschwerdebild an Fachärzte für Psychiatrie oder an Psychotherapeuten. Dort kann eine passende Therapie – sei es Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Medikamente oder eine Kombination – eingeleitet werden.
Was macht der naturheilkundliche Therapeut bei psychischen Störungen?
Ein naturheilkundlicher Therapeut geht bei seelischen Problemen ganzheitlich vor. Das heißt, er betrachtet nicht nur die Symptome, sondern auch Lebensstil, Ernährung, körperliche Verfassung und persönliche Lebensumstände. Im Mittelpunkt steht die Idee, Körper und Geist wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
Zu Beginn findet oft ein längeres Gespräch statt, bei dem der Therapeut zuhört, Fragen stellt und versucht, mögliche Auslöser oder verstärkende Faktoren herauszufinden – zum Beispiel Stress, unausgewogene Ernährung, Schlafmangel oder ungelöste Konflikte.
Die Behandlung selbst kann sehr unterschiedlich aussehen. Häufig werden pflanzliche Präparate wie Johanniskraut oder Baldrian eingesetzt, um Stimmung und Nervensystem sanft zu stabilisieren. Auch Verfahren wie Akupunktur, Homöopathie oder Aromatherapie können Teil des Konzepts sein. Daneben legt die Naturheilkunde großen Wert auf Bewegung, Atemübungen, Meditation und Entspannungstechniken, weil sie das seelische Wohlbefinden unterstützen.
Ernährungsumstellungen oder die Gabe von Vitaminen und Mineralstoffen spielen ebenfalls oft eine Rolle, besonders wenn Mangelzustände als mögliche Ursache in Betracht kommen.
Beispiele zu naturheilkundlichen Behandlungen:
Bei Depressionen
• Johanniskraut: pflanzliches Präparat mit stimmungsaufhellender Wirkung (bei leichten bis mittleren Depressionen).
• Bewegungstherapie: regelmäßige körperliche Aktivität hebt nachweislich die Stimmung.
• Lichttherapie: hilfreich besonders bei saisonalen Depressionen.
• Ernährung: Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und B-Vitamine unterstützen das Nervensystem.
• Achtsamkeits- und Meditationstechniken: helfen, Grübeln zu verringern und innere Ruhe zu fördern.
Bei Angststörungen
• Baldrian, Passionsblume oder Lavendelöl: wirken beruhigend und angstlösend.
• Atemübungen & Yoga: regulieren das Nervensystem und reduzieren innere Unruhe.
• Akupunktur: wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) eingesetzt, um das „Qi“ wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
• Homöopathische Mittel (z. B. Argentum nitricum oder Aconitum, je nach Beschwerdebild): von Heilpraktikern individuell verordnet.
• Progressive Muskelentspannung nach Jacobson: senkt körperliche Anspannung und damit auch Ängste.
Bei Schlafstörungen
• Baldrianwurzel, Melisse, Hopfen: fördern das Einschlafen und verbessern die Schlafqualität.
• Aromatherapie: ätherische Öle wie Lavendel oder Bergamotte wirken beruhigend.
• Schlafhygiene: feste Schlafenszeiten, kein Koffein am Abend, ruhige Schlafumgebung.
• Phytotherapie: Teemischungen mit beruhigenden Kräutern.
• Entspannungsverfahren: Meditation, Autogenes Training oder leichte Abend-Yoga-Übungen.
Was macht der Bioresonanztherapeut, wenn jemand psychische Störungen hat?
Ein Bioresonanztherapeut geht bei psychischen Störungen von der Annahme aus, dass seelische Beschwerden auch mit energetischen Ungleichgewichten im Körper zusammenhängen. Deshalb läuft eine Behandlung meist in mehreren Schritten ab.
Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch, in dem der Therapeut erfährt, welche Beschwerden bestehen – zum Beispiel innere Unruhe, Schlafprobleme, depressive Verstimmungen oder Ängste. Anschließend erfolgt eine Testung mit dem Bioresonanzgerät. Das Gerät soll dabei energetische Regulationsstörungen aufspüren, die mit den psychischen Beschwerden in Verbindung stehen könnten.
In der eigentlichen Behandlung werden spezifische Frequenzspektren dem Körper zugeführt, die entsprechend den Testergebnissen abgeleitet werden und zu denen erfahrungsgemäß ein Zusammenhang besteht. Dadurch soll der Organismus angeregt werden, sich selbst zu regulieren und wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Begleitend geben Bioresonanztherapeuten häufig Empfehlungen zu Ernährung, Stressbewältigung oder pflanzlichen Mitteln, die das seelische Gleichgewicht zusätzlich unterstützen sollen.
Die Methode versteht sich als sanfte, ganzheitliche Unterstützung, die ergänzend eingesetzt werden.
Und was kann jeder selbst tun bei psychischen Störungen?
Jeder Mensch kann selbst einiges tun, um das seelische Gleichgewicht zu stärken – auch wenn bei ernsthaften psychischen Störungen immer therapeutische Hilfe wichtig bleibt. Im Alltag helfen vor allem kleine, regelmäßige Maßnahmen:
• Struktur schaffen: Ein geregelter Tagesablauf mit festen Schlafens- und Essenszeiten gibt Sicherheit und Stabilität.
• Bewegung: Schon 20–30 Minuten Spazierengehen täglich können Stress abbauen und die Stimmung heben.
• Schlafhygiene: Abends zur Ruhe kommen, Bildschirmzeit reduzieren, das Schlafzimmer dunkel und kühl halten.
• Ernährung: Ausgewogen essen, viel frisches Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette – das unterstützt auch das Nervensystem.
• Soziale Kontakte pflegen: Gespräche mit vertrauten Menschen schenken Nähe und verhindern Rückzug.
• Entspannungstechniken: Yoga, Meditation, Atemübungen oder Progressive Muskelentspannung helfen, herunterzufahren.
• Tagebuch oder Journaling: Gedanken und Gefühle aufschreiben kann entlastend wirken und Klarheit schaffen.
• Kleine Freuden bewusst einbauen: Musik hören, ein gutes Buch lesen, kreativ sein – all das gibt positive Impulse.
• Professionelle Hilfe annehmen: Sich Unterstützung zu holen ist ein wichtiger Schritt und kein Zeichen von Schwäche.
Kurz gesagt: Bewegung, Struktur, soziale Nähe und bewusste Erholung sind die besten Werkzeuge, die jeder selbst in der Hand hat, um seine Psyche zu stabilisieren.
Nutzen Sie auch zur vertiefenden Information den kostenlosen eReport „Bioresonanz – eine Chance für die Gesundheit“. Mehr dazu hier:
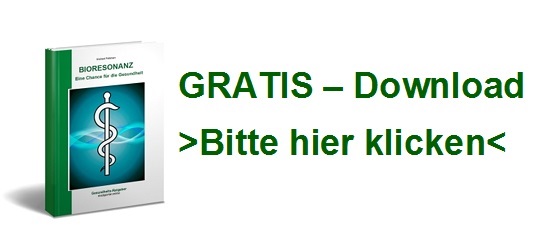
Wichtiger Hinweis: Die Bioresonanz gehört in den Bereich der Erfahrungsmedizin. Die klassische Schulmedizin hat die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt. Die dargestellten Zusammenhänge gehen deshalb teilweise weit über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinaus.
Diese Seiten dienen zu Ihrer Information und Anregung. Sie ersetzen keinesfalls den Arzt oder Heilpraktiker im konkreten Krankheitsfalle.