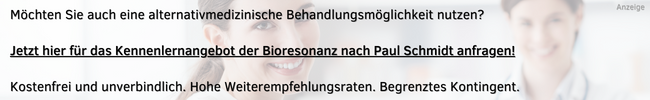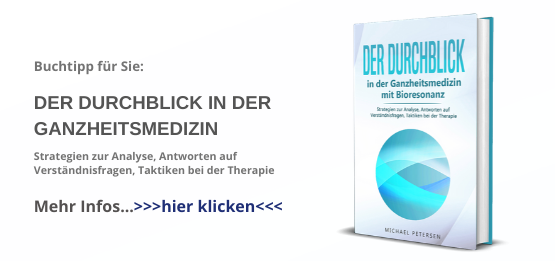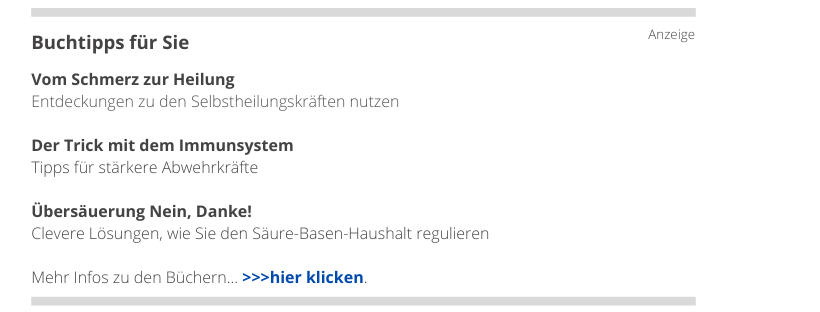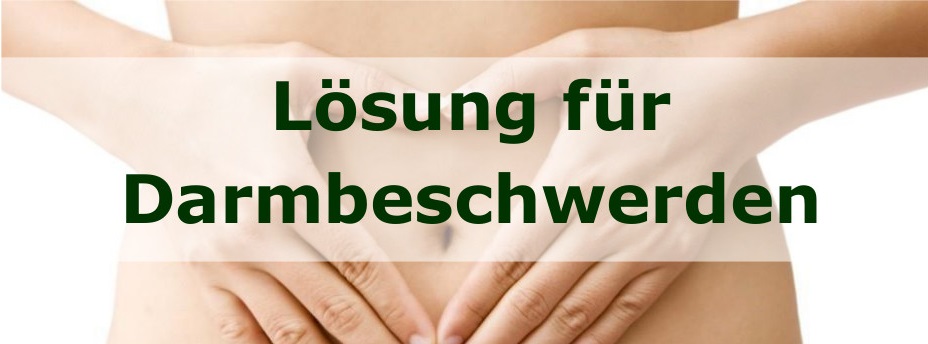Die verschiedenen Sichtweisen in der Medizin verstehen und deren gemeinsamer Nutzen erkennen
In unserer Fortbildungsreihe ordnen wir die Hormonstörungen in die vielseitigen Blickwinkel der Medizin ein.
Was versteht die klinische Medizin unter Hormonstörungen?
In der klinischen Medizin versteht man unter Hormonstörungen Erkrankungen, die durch eine gestörte Produktion, Ausschüttung oder Wirkung von Hormonen entstehen. Hormone sind biochemische Botenstoffe, die in spezialisierten endokrinen Drüsen wie der Schilddrüse, der Bauchspeicheldrüse, den Nebennieren oder der Hypophyse gebildet werden und über das Blut verschiedenste Körperfunktionen regulieren. Kommt es zu einer Störung in diesem fein abgestimmten System, können unterschiedliche Krankheitsbilder entstehen.
Hormonstörungen lassen sich grob in verschiedene Formen einteilen. Eine häufige Ursache ist die Überproduktion von Hormonen (Hyperfunktion), bei der eine Drüse übermäßig viel Hormon ausschüttet. Ein klassisches Beispiel ist die Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose), bei der zu viel Thyroxin gebildet wird. Umgekehrt kann es auch zu einer verminderten Hormonproduktion (Hypofunktion) kommen, wie etwa bei der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), bei der der Körper mit zu wenig Schilddrüsenhormon versorgt wird. Neben diesen beiden Extremen gibt es auch Störungen, bei denen die Hormonproduktion zwar intakt ist, die Wirkung jedoch ausbleibt – etwa bei einer Insulinresistenz, wie sie bei Typ-2-Diabetes mellitus vorkommt. Daneben können Hormonmängel auch durch Schädigungen der hormonproduzierenden Drüsen entstehen, beispielsweise infolge von Autoimmunerkrankungen, Tumoren, Operationen oder genetischen Defekten. Außerdem können hormonaktive Tumoren selbst Hormone produzieren oder das hormonelle Gleichgewicht stören, wie es bei bestimmten Adenomen der Hypophyse der Fall ist.
Je nach betroffener Drüse treten unterschiedliche Krankheitsbilder auf. Die Hypophyse kann unter anderem durch eine Insuffizienz oder durch gutartige Tumoren wie ein Prolaktinom gestört sein. Die Schilddrüse ist häufig bei Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis (Unterfunktion) oder Morbus Basedow (Überfunktion) betroffen. Die Nebennieren können bei Krankheiten wie dem Morbus Addison (Unterfunktion) oder dem Cushing-Syndrom (Überfunktion) gestört sein. In der Bauchspeicheldrüse spielt vor allem der Diabetes mellitus – insbesondere Typ 1 und Typ 2 – eine zentrale Rolle. Auch die Keimdrüsen (Ovarien und Hoden) können hormonell bedingte Störungen zeigen, etwa bei einem Hypogonadismus oder dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS).
Die Symptome von Hormonstörungen sind sehr vielfältig und hängen von der Art und Schwere der Erkrankung ab. Häufige Beschwerden sind Müdigkeit, Leistungsschwäche, Gewichtszunahme oder -abnahme, Stimmungsschwankungen, Zyklusstörungen, Wachstumsauffälligkeiten sowie Veränderungen des Blutdrucks.
Die Diagnostik basiert in der Regel auf einer ausführlichen Anamnese, einer körperlichen Untersuchung sowie Laboruntersuchungen zur Bestimmung von Hormonspiegeln im Blut. Ergänzend können bildgebende Verfahren wie Ultraschall, CT oder MRT eingesetzt werden. In bestimmten Fällen kommen auch Funktionstests wie ein ACTH-Stimulationstest oder ein Glukosebelastungstest zum Einsatz.
Die Behandlung richtet sich nach der zugrunde liegenden Ursache. Bei Hormonmangelzuständen wird häufig eine Hormonersatztherapie eingesetzt, etwa mit Insulin bei Diabetes mellitus oder mit L-Thyroxin bei Hypothyreose. Bei Überfunktionen kann eine medikamentöse Hemmung der Hormonproduktion notwendig sein. Bei hormonproduzierenden Tumoren kommen operative Maßnahmen oder eine Strahlentherapie in Betracht. Darüber hinaus spielen bei vielen hormonellen Störungen auch Lebensstilveränderungen wie eine angepasste Ernährung und körperliche Aktivität eine wichtige Rolle.
Was bedeuten Hormonstörungen aus ganzheitlicher Sicht?
Aus ganzheitlicher Sicht werden Hormonstörungen nicht nur als rein biochemische oder organische Fehlfunktionen betrachtet, sondern als Ausdruck eines gestörten inneren Gleichgewichts. Der Mensch wird als Einheit aus Körper, Geist und Seele verstanden, wobei alle Ebenen in Wechselwirkung stehen. Hormonstörungen gelten demnach oft als Symptome einer tieferliegenden Dysbalance im gesamten System.
Grundprinzipien der ganzheitlichen Sichtweise:
1. Körper-Geist-Seele-Verbindung
Hormone beeinflussen nicht nur körperliche Prozesse, sondern auch Stimmung, Verhalten und innere Ausgeglichenheit. Umgekehrt wirken sich psychische Belastungen, ungelöste Konflikte oder dauerhafter Stress stark auf das hormonelle Gleichgewicht aus. So kann z. B. chronischer Stress zu einer Überforderung der Nebennieren führen (Stichwort: Nebennierenschwäche), oder emotionale Traumata können mit Zyklusstörungen oder Schilddrüsenproblemen in Verbindung stehen.
2. Stress als zentraler Einflussfaktor
In der ganzheitlichen Medizin – insbesondere in der Psychoneuroendokrinologie – wird Stress als einer der Hauptauslöser hormoneller Dysregulation betrachtet. Dauerhafte Aktivierung der Stressachsen (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse) kann langfristig die Produktion von Cortisol, Schilddrüsenhormonen, Sexualhormonen oder Insulin aus dem Gleichgewicht bringen.
3. Lebensweise und Ernährung
Eine unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel, Schlafstörungen und Umweltgifte können hormonelle Regelkreise stören. Auch die Darmgesundheit wird ganzheitlich stark betont, da sie mit dem Hormonhaushalt über Mikronährstoffe, Entzündungsprozesse und das Mikrobiom in enger Verbindung steht.
4. Wechselwirkungen mit der Umwelt
Umweltfaktoren wie hormonaktive Substanzen (z. B. Weichmacher, Pestizide, Kosmetika mit hormonähnlicher Wirkung – sog. „endokrine Disruptoren“) können das Hormonsystem beeinflussen. Ganzheitliche Ansätze empfehlen daher oft eine möglichst schadstoffarme Lebensweise.
5. Emotionale und energetische Aspekte
In manchen ganzheitlich Systemen (z. B. TCM, Ayurveda oder anthroposophischer Medizin) werden Hormondrüsen mit bestimmten seelischen Themen oder energetischen Zentren (z. B. Chakren) in Verbindung gebracht. Eine Störung wird als Zeichen dafür interpretiert, dass innere Bedürfnisse übergangen oder seelische Prozesse nicht beachtet wurden.
Beispiele für ganzheitliche Therapieansätze:
• Individuelle Lebensstilberatung: Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, Schlaf
• Pflanzenheilkunde (Phytohormone): z. B. Mönchspfeffer, Maca, Yamswurzel
• Naturheilkundliche Verfahren: Homöopathie, Schüßler-Salze, Bachblüten
• Mind-Body-Medizin: Achtsamkeit, Meditation, Psychotherapie, Körpertherapie
• Darmgesundheit: Mikrobiomaufbau, Entgiftung
• Energetische Methoden: Bioresonanztherapie, Akupunktur, Reiki, Chakrenarbeit
Fazit:
Aus ganzheitlicher Sicht sind Hormonstörungen ein Signal des Körpers, dass etwas im gesamten System aus dem Gleichgewicht geraten ist – sei es durch äußere Belastungen, psychischen Stress oder Lebensstilfaktoren. Die Behandlung zielt daher nicht nur auf die Symptombehebung, sondern auf die Wiederherstellung eines umfassenden inneren Gleichgewichts.
Welche Erkenntnisse gibt es zu Hormonstörungen aus neuerer Wissenschaft?
1. Epigenetik: Umwelteinflüsse auf die Genregulation
Umweltfaktoren wie Ernährung, Stress und Schadstoffe können epigenetische Veränderungen hervorrufen, die die Genexpression beeinflussen und das Risiko für hormonelle Störungen erhöhen. Solche Veränderungen können sogar über Generationen hinweg weitergegeben werden.
2. Psychoneuroendokrinologie: Stress und Hormonsystem
Chronischer Stress beeinflusst die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse), was zu einer Dysregulation von Cortisol und anderen Hormonen führen kann. Dies hat Auswirkungen auf Stimmung, Schlaf und das Immunsystem.
3. Darm-Hormon-Achse: Mikrobiom und Hormonbalance
Das Darmmikrobiom spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Hormonen wie Östrogen und Cortisol. Eine gestörte Darmflora kann zu hormonellen Ungleichgewichten führen, die beispielsweise mit PMS oder Endometriose in Verbindung stehen.
4. Endokrine Disruptoren: Chemikalien und Hormonsystem
Bestimmte Chemikalien, wie Phthalate und Bisphenol A (BPA), können das Hormonsystem stören, indem sie natürliche Hormone nachahmen oder blockieren. Dies kann zu Problemen wie Unfruchtbarkeit, Schilddrüsenstörungen und frühzeitiger Pubertät führen.
5. Leptinresistenz: Hormonelle Aspekte von Übergewicht
Leptin ist ein Hormon, das das Sättigungsgefühl reguliert. Bei Übergewicht kann eine Leptinresistenz auftreten, bei der das Gehirn nicht mehr angemessen auf Leptin reagiert, was zu anhaltendem Hungergefühl und weiteren Gewichtszunahmen führt.
6. Personalisierte Endokrinologie: Individuelle Hormontherapien
Moderne Ansätze in der Endokrinologie setzen auf personalisierte Hormontherapien, die auf individuellen genetischen Profilen und spezifischen Hormonspiegeln basieren. Dies ermöglicht eine gezieltere und effektivere Behandlung hormoneller Störungen.
7. Chronobiologie: Biorhythmen und Hormonregulation
Die innere Uhr des Körpers beeinflusst die Ausschüttung verschiedener Hormone. Störungen des zirkadianen Rhythmus, etwa durch Schichtarbeit oder Schlafmangel, können das hormonelle Gleichgewicht beeinträchtigen.
Welchen Blickwinkel haben Bioresonanz-Therapeuten auf Hormonstörungen?
Bioresonanz-Therapeuten betrachten Hormonstörungen als Ausdruck eines gestörten energetischen Gleichgewichts im Körper. Aus ihrer Sicht entstehen hormonelle Dysbalancen oft durch äußere oder innere Belastungsfaktoren, die das feine Regulationssystem des Organismus beeinträchtigen. Dazu zählen unter anderem Umweltgifte, Elektrosmog, chronischer Stress, unverträgliche Nahrungsmittel, frühere Infektionen, emotionale Belastungen, oder auch im Organismus angelegte Regulationsstörungen. Diese Faktoren sollen das bioenergetische Feld des Körpers verändern und so störend auf das Hormonsystem wirken.
Im Rahmen der Bioresonanztherapie wird angenommen, dass sich jede Zelle und jedes Organ durch spezifische elektromagnetische Schwingungen charakterisiert. Bei Erkrankungen oder Belastungen verändern sich diese Schwingungen. Bioresonanz-Therapeuten nutzen spezielle Geräte, um diese gestörten Frequenzmuster zu erkennen und gezielt zu harmonisieren. Die Analyse kann Hinweise auf betroffene hormonregulierende Organe wie die Schilddrüse, die Nebennieren, die Eierstöcke oder die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) geben. Auch die übergeordnete Regulation über den Hypothalamus wird berücksichtigt.
Die Therapie erfolgt, indem mit spezifischen Frequenzspektren harmonisiert wird. Ziel ist es, die Selbstregulation des Körpers zu unterstützen, sodass das Hormonsystem wieder in Balance kommt. Häufig wird die Bioresonanzbehandlung mit ergänzenden Maßnahmen kombiniert – etwa der Ausleitung von ausscheidungspflichtigen Stoffen, der Stärkung von Leber, Niere und Lymphe, der Behandlung von Stressfaktoren sowie einer angepassten Ernährung. Auch pflanzliche Mittel, Homöopathie oder Bachblüten finden oft begleitend Anwendung.
Aus Sicht der Schulmedizin ist die Wirksamkeit der Bioresonanztherapie durch evidenzbasierte wissenschaftliche Studien nicht nachgewiesen. Dennoch berichten viele Patientinnen und Patienten, insbesondere bei funktionellen oder hormonellen Beschwerden ohne klar fassbare organische Ursache, von einer Verbesserung ihres Befindens.
Welche Lösungen gibt es zur Selbsthilfe, um Hormonstörungen zu begegnen?
Es gibt eine Reihe ganzheitlicher Ansätze zur Selbsthilfe bei Hormonstörungen, die auf natürlichen, lebensstilbasierten Maßnahmen beruhen. Sie können helfen, das hormonelle Gleichgewicht sanft zu unterstützen – besonders bei funktionellen Störungen, wie etwa Zyklusunregelmäßigkeiten, PMS, Schilddrüsenunterfunktion, Wechseljahresbeschwerden oder Nebennierenschwäche. Hier eine strukturierte Übersicht zur Orientierung. Selbstverständlich ersetzt dies keine individuelle Lösung im Einzelfall.
1. Ernährung als hormonelle Basis
Die Ernährung hat großen Einfluss auf das endokrine System. Ziel ist eine hormonfreundliche, entzündungshemmende Kost:
• Blutzuckerstabilisierung durch regelmäßige, vollwertige Mahlzeiten (Vermeidung von Zucker und Weißmehl)
• Hormonaktive Nährstoffe wie Zink, Selen, B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3
• Leberfreundliche Lebensmittel (Artischocke, Bitterstoffe, Kreuzblütler wie Brokkoli), da die Leber am Hormonhaushalt beteiligt ist
• Vermeidung von Xenoöstrogenen in Plastik, Kosmetika oder konventionellen Tierprodukten
2. Stressabbau und Nervensystem-Regulation
Chronischer Stress beeinflusst direkt die Achse Hypothalamus-Hypophyse-Nebennieren und kann zu Hormonentgleisungen führen:
• Achtsamkeit und Meditation zur Beruhigung des Nervensystems
• Atemtechniken und Yoga (besonders Yin Yoga, Restorative Yoga)
• Rhythmisierung des Alltags, z. B. durch feste Schlafenszeiten und bewusste Pausen
• Adaptogene Pflanzen wie Ashwagandha, Rhodiola oder Heilpilze (nach fachkundiger Rücksprache)
3. Natürliche Pflanzenkraft
Bestimmte Heilpflanzen haben eine regulierende Wirkung auf das Hormonsystem:
• Mönchspfeffer (besonders bei Zyklusunregelmäßigkeiten)
• Yamswurzel (bei Progesteronmangel und Wechseljahresbeschwerden)
• Schafgarbe, Frauenmantel, Rotklee – traditionell in der Frauenheilkunde eingesetzt
• Passionsblume, Baldrian – bei hormonell bedingten Stimmungsschwankungen oder Schlafproblemen
4. Schlaf und zirkadianer Rhythmus
Ein stabiler Schlaf-Wach-Rhythmus fördert die Produktion wichtiger Hormone wie Melatonin, Cortisol und Wachstumshormon:
• Regelmäßiger Schlafzeitpunkt, möglichst vor 23 Uhr
• Vermeidung von Blaulicht am Abend, ggf. Blaulichtfilter nutzen
• Schlafhygiene-Routinen: Dunkelheit, Ruhe, kein Handy im Bett
5. Entlastung von hormonbelastenden Stoffen
Viele hormonähnliche Substanzen aus der Umwelt wirken wie „endokrine Disruptoren“:
• Plastik vermeiden, besonders bei Lebensmitteln (kein Aufwärmen in Plastik)
• Naturkosmetik verwenden, frei von Parabenen, Phthalaten & Co.
• Haushaltsmittel umstellen auf ökologisch unbedenkliche Alternativen
6. Bewegung mit Maß
Regelmäßige, maßvolle Bewegung stabilisiert Blutzucker, regt Stoffwechsel und Hormonproduktion an:
• Moderates Ausdauertraining wie Spazierengehen, Wandern, Schwimmen
• Zyklussensible Bewegung – intensive Sportarten ggf. dem Hormonverlauf anpassen
• Krafttraining kann unterstützend auf Östrogen- und Testosteronspiegel wirken
7. Emotionale Verarbeitung und Körperarbeit
Unverarbeitete Emotionen und alte Prägungen können unbewusst hormonell wirken:
• Körperpsychotherapie, Somatic Experiencing, EMDR (bei tiefer liegenden Themen)
• Kreative Ausdrucksformen wie Journaling, Tanzen oder intuitives Malen
• Weibliche Zyklusarbeit oder Menstruationsachtsamkeit zur Selbstwahrnehmung
Wichtig: Individuelle Ursachen erkennen
Hormonstörungen haben sehr unterschiedliche Ursachen. Ein hilfreicher Schritt zur Selbsthilfe ist oft, die eigene Geschichte besser zu verstehen – etwa:
• Gab es einschneidende Lebensereignisse?
• Wie war die eigene Pubertät, Schwangerschaft oder die Zeit nach hormoneller Verhütung?
• Gibt es Hinweise auf Nährstoffmängel, Darmprobleme, stille Entzündungen?
Nutzen Sie auch zur vertiefenden Information den kostenlosen eReport „Bioresonanz – eine Chance für die Gesundheit“. Mehr dazu hier:
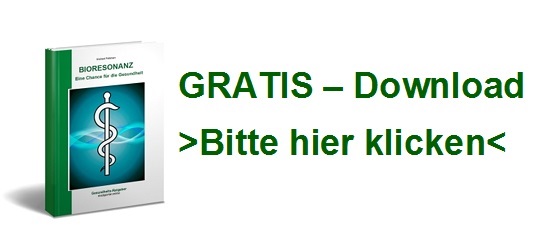
Wichtiger Hinweis: Die Bioresonanz gehört in den Bereich der Erfahrungsmedizin. Die klassische Schulmedizin hat die Wirkung bioenergetischer Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt. Die dargestellten Zusammenhänge gehen deshalb teilweise weit über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinaus.
Diese Seiten dienen zu Ihrer Information und Anregung. Sie ersetzen keinesfalls den Arzt oder Heilpraktiker im konkreten Krankheitsfalle.